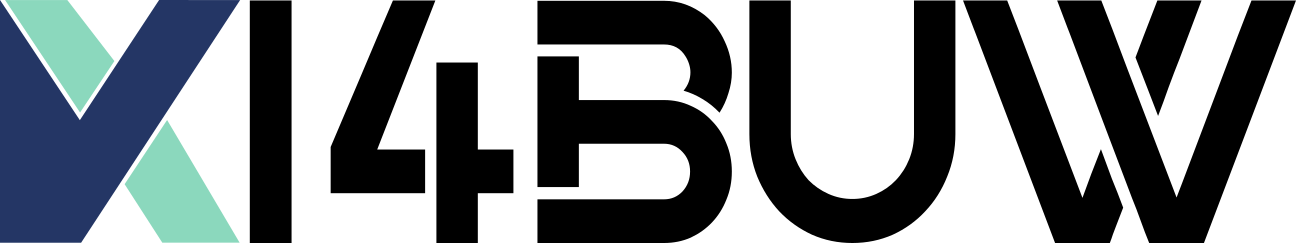KI-gestützte Überwachung der Feuersalamanderpopulation zum Schutz der Tiere vor anthropogen verursachten Bedrohungen
Titel des Projekts:
Projektpartner:
Ansprechpartner:
Da Schwanzlurche über ihre Haut den lebensnotwendigen Sauerstoff aufnehmen, verenden bei den Feuersalamandern die meisten der infizierten Tiere in kürzester Zeit an den Folgen der Hautzerstörung durch den Hautpilz. Die Verbreitung des Hautpilzes hat in den vergangenen Jahren, besonders in den Niederlanden und Deutschland, deutlich zugenommen und die betroffenen lokalen Populationen teilweise ausgelöscht oder sehr stark dezimiert. Eine systematische, flächendeckende und wissenschaftlich fundierte Erfassung der Populationen und der Ausbreitung des Hautpilzes erfolgt bisher nicht.
Mit unserem interdisziplinären Projekt möchten wir einen Beitrag zum Schutz der europäischen Feuersalamander, einer Untergruppe der Schwanzlurche, leisten. Die lokalen Populationen und die Ausbreitung des Hautpilzes in Deutschland – als Pilotprojekt im Bergischen Städtedreieck – sollen mithilfe von Smartphones erhoben und deren Änderungen über die Zeit verfolgt werden. Durch die wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation sollen die Ausbreitung und der Einfluss des tödlichen Hautpilzes auf die lokalen Populationen erfasst und analysiert werden. Diese Informationen werden anschließend für die Ableitung von fundierten Gegenmaßnahmen genutzt.
Gemeinsam mit unserem Partner aus der Zoologie und Biologiedidaktik der BUW entwickeln wir eine mobile App sowie die dazugehörige Infrastruktur, um benutzerfreundlich mit Mobilgeräten standardisierte Fotografien von den in der Natur angetroffenen Feuersalamandern anzufertigen. Diese Daten werden mit Metadaten wie dem GPS-Standort des jeweiligen Funds sowie dem Zustand des Tiers angereichert und in einer Datenbank gespeichert. Ferner wird das Foto des aufgefundenen Feuersalamanders mittels KI-basierter Bildverfahren mit bereits dokumentierten Individuen verglichen und somit ggf. re-identifiziert. Die erhobenen Daten werden anschließend zur Abschätzung der jeweiligen lokalen Populationsgröße und der Ausbreitung des Hautpilzes herangezogen.